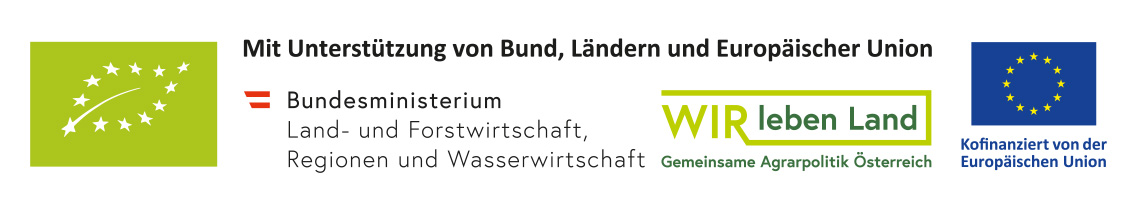Nachhaltigkeit ist nicht nur eine Frage des Konsums der Einzelpersonen, sondern auch der politischen Weichenstellung. Obwohl der Bio-Konsum in Österreich auf einem Rekordhoch ist, fehlt es immer noch an gezielter Unterstützung durch die öffentliche Hand. Staatliche Institutionen könnten durch gezielte Maßnahmen den Markt erheblich beeinflussen und den Wandel zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft beschleunigen. Doch bisher bleiben viele Potenziale ungenutzt, während der Exportdruck auf heimische Biobetriebe wächst.
Bio-Konsum in Österreich auf Rekordhoch
Trotz der Herausforderungen steigt der Konsum von Biolebensmitteln in Österreich weiter an. Laut AMA-Marketing gaben Haushalte 2024 durchschnittlich 340 Euro für Bio-Produkte aus. Sowohl die verkaufte Menge an Bio-Produkten (mit einem „All-Time-High“ von plus 5,5 Prozent) als auch der Umsatz mit Bio-Produkten (plus 3,7 Prozent) ist 2024 im Vergleich zu 2023 gestiegen. Besonders junge Konsumenten und Konsumentinnen treiben diese Entwicklung voran.
Biofleisch bleibt mit einem Anteil von 7,6 Prozent am Gesamtmarkt zwar weiterhin ein Nischenprodukt, während jedoch bereits 30 Prozent der Trinkmilch in Bioqualität gekauft wird. Aktuell arbeiten 23 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe in Österreich nach biologischen Standards und bewirtschaften damit 27,3 Prozent der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche.
Fehlende Unterstützung durch die öffentliche Hand
Trotz diesem anhaltenden Trend fehlt es an Unterstützung aus öffentlicher Hand. Diese könnte als Großeinkäufer für Schulen, Krankenhäuser und Kantinen nämlich erheblichen Einfluss auf die Marktentwicklung nehmen, hat jedoch in dieser Form bislang wenig zur Förderung der Bio-Produktion beigetragen.
Die Initiative „Enkeltaugliches Österreich“ arbeitet mit Wissenschaftlern daran, die versteckten Folgekosten konventioneller Landwirtschaft durch Pestizide und Kunstdünger aufzuzeigen, um ein Bewusstsein für Ganzheitlichkeit zu schaffen. Der Preis für Biolebensmittel sei zwar kurzfristig höher – berücksichtige man die langfristigen Kosten, sehe diese Rechnung jedoch vollkommen anders aus.
Export als Problem
Barbara Holzer-Rappoldt, Mitbegründerin der Initiative, betont, dass Biobetriebe oft gezwungen seien, in den Export zu gehen, da es in Österreich zu wenige Abnehmer in der öffentlichen Beschaffung gibt und das sich dies umgehend ändern sollte.
Export ist vor allem deshalb ein brisantes Thema, da auch Deutschland immer mehr Bio-Waren aus Österreich importiert und so vermehrt Kooperationen mit den hiesigen Bio-Produzenten eingeht. Was die heimischen Bio-Produzenten natürlich immer mehr aus dem österreichischen Markt weglockt, so dass es hierzulande zu gravierenden Engpässen kommen könnte.
Es ist daher umso wichtiger, die Zahl der hiesigen Bio-Produzenten zu erhöhen. Was eine wirkliche Herausforderung ist, da, entgegen dem Trend zu dem Kauf von mehr Bio, es immer weniger Biobauern gibt. Seit 2022 haben nämlich rund 1.000 Betriebe aufgegeben, allein 2024 kündigten 351 ihre Bioverträge. Zudem nahm auch der Bio-Flächen-Anteil um 10.000 ha, das sind minus 1,5 %, ab und liegt nun bei 27,1 % oder 695.180 ha, wie agrarheute berichtet.
Der Umstieg auf Bio-Lebensmittel
Auch ist der Umstieg auf einen Bio-Betrieb alles andere als ein bürokratiefreies Unterfangen. Dabei unterstützt die ARGE NahtürlichBIO all jene Gastrobetriebe und Großküchen dabei, auf den Einsatz von Bio-Lebensmitteln umzusteigen und bietet gezielte Fachveranstaltungen in verschiedensten Themenbereichen, individuelle Vor-Ort-Beratung durch geschulte BIO-BotschafterInnen sowie die Bereitstellung von wertvollen, fachgerechten Informationen (Zertifizierungs-Leitfaden, eigener Gäste-Folder, usw.).
„In der ARGE NahtürlichBIO arbeiten wir intensiv zusammen, um unsere jeweiligen Stärken zu nutzen und uns so gegenseitig zu stärken. Durch unterschiedlichste Maßnahmen entlang der Wertschöpfungskette unterstützen wir beim Ausbau der BIO-Produktion sowie informieren wir besonders über die wichtige Rolle der Tierhaltung für geschlossene Nährstoffkreisläufe in einer ganzheitlich gedachten BIO-Landwirtschaft.“, erklärt Geschäftsführer Lukas Hochwallner.
Biomarkt und die Politik
Die steigende Nachfrage nach Bio-Produkten zeigt, dass nachhaltige Landwirtschaft einen immer größeren Stellenwert in der Gesellschaft einnimmt. Doch während Konsumenten und Konsumentinnen zunehmend Bio bevorzugen, fehlt es an entsprechender Unterstützung durch die Politik. Staatliche Institutionen könnten durch gezielte Fördermaßnahmen und eine strategische Beschaffungspolitik den Bio-Sektor weiter stärken und unabhängiger vom Export machen. Nur durch langfristige politische und wirtschaftliche Weichenstellungen kann sichergestellt werden, dass die nachhaltige Landwirtschaft in Österreich eine gesicherte Zukunft hat.
Titelbild @ Joakim Honkasalo via unsplash (Zugriff 13.03.2025)