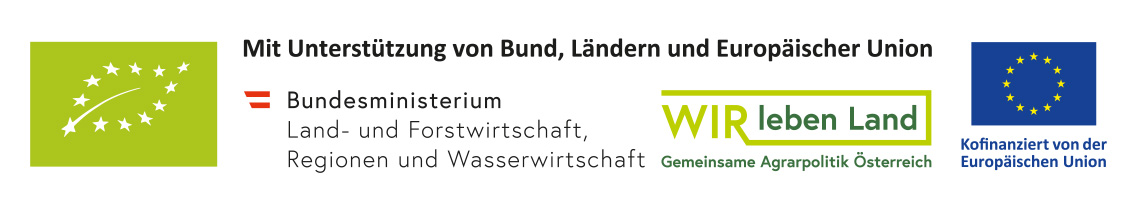Die Auswirkungen des Fleischkonsums auf Umwelt und Gesundheit sind unbestritten. Studien zeigen, dass die Fleischproduktion erheblich zu Klimawandel, Störung biochemischer Kreisläufe und Biodiversitätsverlust beiträgt. Gleichzeitig birgt ein übermäßiger Konsum von rotem und verarbeitetem Fleisch gesundheitliche Risiken wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes. Besonders in einkommensstarken Ländern wie Deutschland, wo der Fleischkonsum 2022 durchschnittlich 1000 g pro Woche pro Kopf betrug, wird eine Reduktion des Konsums dringend empfohlen.
Auch in Österreich ist der Fleischkonsum vergleichsweise hoch. Laut Statistik Austria konsumierte jeder Österreicherin im Jahr 2022 im Durchschnitt 63 kg Fleisch, was etwa 1200 g pro Woche entspricht – deutlich mehr als die von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfohlenen 300 g pro Woche. Ein Umdenken in Richtung eines nachhaltigeren und bewussteren Konsumverhaltens ist daher auch hierzulande wichtig.
Doch was beeinflusst unseren Fleischkonsum im Alltag? Eine neue Studie von Patricia Wowra und ihrem Team geht dieser Frage nach. Im Rahmen einer fünf Tage dauernden Tagebuchstudie dokumentierten 230 Teilnehmende insgesamt 2461 Mahlzeiten und die dazugehörigen Situationen. Dabei wurden sowohl individuelle als auch situative Faktoren untersucht.
Ergebnisse der Studie
Die Analyse zeigt:
- Fleisch wird häufiger konsumiert, wenn Mahlzeiten hungrig, in Gesellschaft anderer und später am Tag (mittags oder abends) eingenommen werden.
- Der Zusammenhang zwischen Hunger und Zeit mit Fleischkonsum beruht auf individuellen Schwankungen, während die soziale Komponente sowohl intra- als auch interindividuelle Einflüsse hat.
- Soziodemografische Eigenschaften wie Alter, Geschlecht oder Einkommen hatten keinen signifikanten Einfluss auf den Fleischkonsum.
Diese Erkenntnisse verdeutlichen, dass situative Faktoren eine entscheidende Rolle spielen. Sie eröffnen neue Ansatzpunkte für Maßnahmen, die gezielt auf bestimmte Situationen oder Personengruppen ausgerichtet sind.
Warum ist das wichtig?
Die Reduktion des Fleischkonsums ist ein zentraler Baustein für eine nachhaltigere Ernährung – nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich. Initiativen, die das Bewusstsein für umweltfreundlichere und gesündere Alternativen fördern, könnten hier ansetzen. Gerade in der Gemeinschaftsverpflegung, wie etwa in Schulkantinen oder Großküchen, könnte eine verstärkte Orientierung an pflanzlichen und regionalen Bio-Produkten langfristig einen Unterschied machen.
Eine solche Verhaltensänderung hin zu einem nachhaltigeren Fleischkonsum könnte nicht nur den ökologischen Fußabdruck verringern, sondern auch zur Förderung einer bewussten und gesunden Lebensweise beitragen.