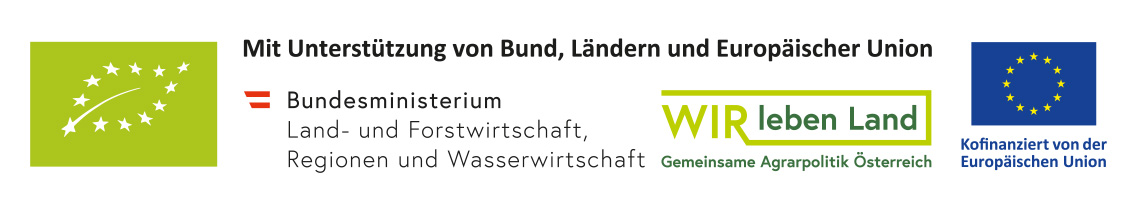In den letzten Jahren hat der Konsum von Bio-Lebensmitteln in Österreich und anderen europäischen Ländern deutlich zugenommen. Verbraucherinnen und Verbraucher schätzen insbesondere die höheren Standards in der Tierhaltung, den Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel und die Förderung der Biodiversität. Doch trotz dieses wachsenden Interesses basiert das Vertrauen in Bio-Produkte häufig mehr auf persönlichen Einschätzungen als auf fundiertem Wissen. Eine Studie der Georg-August-Universität Göttingen hat dieses Phänomen genauer untersucht und zeigt auf, dass ein tiefergehendes Verständnis der Bio-Richtlinien notwendig ist, um informierte Kaufentscheidungen treffen zu können.
Ergebnisse der Göttinger Studie
Die dreijährige Studie der Universität Göttingen ergab, dass viele Verbraucherinnen und Verbraucher positive Aspekte der Bio-Tierhaltung hervorheben, wie etwa mehr Platz, Auslaufmöglichkeiten und eine generell bessere Haltung der Tiere.
Allerdings stellte sich heraus, dass dieses Vertrauen oft auf persönlichen Einschätzungen beruht und nicht unbedingt auf detaillierten Kenntnissen über die spezifischen Bio-Richtlinien. Beispielsweise gingen viele Befragte irrtümlicherweise davon aus, dass es im Bio-Bereich spezielle Regelungen für Transport und Schlachtung gibt, obwohl diese nicht immer vorhanden sind.
Unbekannte Vorteile und Verbesserungspotential
Neben den bekannten Vorteilen der Bio-Landwirtschaft, wie dem Verzicht auf chemische Pflanzenschutzmittel und der Förderung der Bodenfruchtbarkeit, gibt es weitere positive Aspekte, die vielen Konsumentinnen und Konsumenten weniger bekannt sind.
Dazu zählen beispielsweise strengere Kontrollen und Zertifizierungsverfahren, die sicherstellen, dass Bio-Produkte den festgelegten Bio-Standards entsprechen. Um diese Vorteile stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken, empfehlen die ExpertInnen der Göttinger Studie eine transparentere und klarere Kommunikation seitens der Bio-Branche.
Zudem wird vorgeschlagen, die Standards in Bereichen wie der Schlachtung zu erhöhen, um den Erwartungen der Verbraucherinnen und Verbraucher besser gerecht zu werden.

Bio-Konsum in Österreich: Zwischen Vertrauen und Kenntnisse
In Österreich ist der Bio-Sektor besonders stark ausgeprägt. Bereits in den 1920er-Jahren entstand in Kärnten der erste Betrieb mit biologisch-dynamischer Wirtschaftsweise. Heute wird über ein Viertel (27,4 Prozent) der landwirtschaftlich genutzten Fläche biologisch bewirtschaftet, und jeder fünfte Hof in Österreich ist ein Bio-Hof. Damit hat Österreich das Ziel der EU-Strategie für ein umweltfreundlicheres Lebensmittelsystem – 25 Prozent der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche in der EU bis 2030 biologisch zu bewirtschaften – bereits erreicht.
Bereits 2017 zeigte eine Studie von Gallup Austria, dass 70 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher zumindest gelegentlich Bio-Lebensmittel kaufen, wobei 2 Prozent ausschließlich Bio-Produkte konsumieren. Dennoch konsumierte zu der Zeit rund ein Drittel der Bevölkerung (28 Prozent) selten oder nie Bio-Produkte. Diese Zahlen verdeutlichten schon damals das hohe Vertrauen in Bio-Produkte der österreichischen Bevölkerung.
Bio-Markt Österreich heute
Neuere Daten bezeugen diesbezüglich eine anhaltend positive Entwicklung des Bio-Marktes in Österreich. 2023 wurden im Lebensmitteleinzelhandel bereits Bio-Lebensmittel im Wert von 873 Millionen Euro gekauft, was einer Umsatzsteigerung von 5,3% gegenüber 2022 entspricht. Der Marktanteil von Bio-Produkten in Österreich, was den Lebensmitteleinzelhandel betrifft, liegt bei beachtlichen 10% und damit im europäischen Spitzenfeld. Dem gegenübergestellt sind lediglich „geschätzte drei Prozent“ der Lebensmittel, die für die Gastronomie gekauft werden, Bio.

Die Rolle der Authentizität und des Vertrauens
Das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher in die Echtheit von Bio-Produkten ist entscheidend für den Erfolg des Bio-Sektors. Eine Studie des Bundesprogramms Ökologischer Landbau (BÖL) ergab, dass nur jeder Dritte voll auf die Echtheit von Bio-Produkten vertraut.
Diese Skepsis resultiert oft aus mangelnder Transparenz und unzureichender Kommunikation seitens der Hersteller und Händler. Hat aber mit Sicherheit auch mit der hohen Anzahl der von den Unternehmen selbst erfundenen „Qualitätszeichen“ zu tun. Diese halten sich dabei nicht an die verbindlichen und gesetzlichen Regelungen der Bio-Landwirtschaft, sondern lediglich an von den Unternehmen selbst definierte „Nachhaltigkeitsziele“.
Um das Vertrauen zu stärken, ist es wichtig, dass die gesamte Produktions- und Lieferkette transparent gestaltet wird. Verbraucherinnen und Verbraucher wünschen sich klare Informationen über die Herkunft der Produkte, die angewandten Produktionsmethoden und die Einhaltung der Bio-Standards.
Innovative Kommunikationsansätze, wie sie im AVOeL-Projekt der Universität Göttingen entwickelt wurden, können dazu beitragen, die Authentizität von Bio-Lebensmitteln zu betonen und das Vertrauen der Konsumentinnen und Konsumenten zu stärken.
Mehr Bio-Wissen für informierte Entscheidungen
Der Bio-Sektor hat in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen, und das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher in Bio-Produkte ist hoch. Dennoch zeigt sich, dass dieses Vertrauen oft auf persönlichen Einschätzungen beruht und nicht immer auf fundierten Kenntnissen über die spezifischen Bio-Standards. Um informierte Kaufentscheidungen treffen zu können, ist es daher essenziell, das Wissen über die Bio-Landwirtschaft und ihre Richtlinien zu vertiefen.
Eine transparente und klare Kommunikation seitens der Bio-Branche, die Hervorhebung der unbekannten Vorteile der Bio-Produktion und die Anpassung der Standards an die Erwartungen der Verbraucherinnen und Verbraucher können dazu beitragen, das Vertrauen zu stärken und den Bio-Sektor weiter voranzubringen. Letztlich liegt es auch an den Konsumentinnen und Konsumenten, sich aktiv zu informieren und kritisch zu hinterfragen, um die Vorteile der Bio-Landwirtschaft voll ausschöpfen zu können.