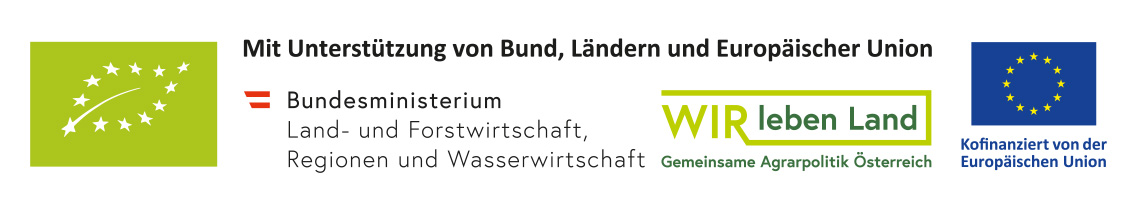Die regenerative Landwirtschaft setzt auf natürliche Prozesse, um Bodenfruchtbarkeit zu erhalten und Klimaschutz zu fördern. Durch gezielte Maßnahmen wie Fruchtfolgen, Humusaufbau und Weidehaltung werden Ökosysteme gestärkt und Nährstoffkreisläufe geschlossen. Besonders Leguminosen und Dauergrünland spielen eine Schlüsselrolle in diesem nachhaltigen Ansatz.
Regenerative Landwirtschaft: zurück zu den natürlichen Kreisläufen
Die regenerative Landwirtschaft gewinnt zunehmend an Bedeutung, da sie sich aktiv um die Wiederherstellung und Verbesserung natürlicher Kreisläufe bemüht. Durch den gezielten Einsatz natürlicher Düngemittel, vielfältige Fruchtfolgen und eine nachhaltige Bodenbewirtschaftung trägt sie nicht nur zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit bei, sondern leistet auch einen wesentlichen Beitrag zur Kohlenstoffspeicherung und damit zur Bekämpfung des Klimawandels. Besonders im Fokus stehen Leguminosen und Dauergrünland, die eine entscheidende Rolle in diesem System spielen.
Die Rolle von Leguminosen in der regenerativen Landwirtschaft
Ein zentraler Aspekt der regenerativen Landwirtschaft ist der bewusste Verzicht auf synthetische Düngemittel, insbesondere leichtlösliche Stickstoffdünger. Stattdessen setzt man auf die Fähigkeit bestimmter Pflanzen, insbesondere Leguminosen wie Erbsen, Bohnen, Soja oder Lupinen, Stickstoff aus der Luft zu binden und für nachfolgende Kulturen verfügbar zu machen. Diese Pflanzen gehen eine Symbiose mit Knöllchenbakterien (Rhizobien) ein, die Stickstoff in eine für Pflanzen verwertbare Form umwandeln.
Durch den gezielten Anbau von Leguminosen sowie den Einsatz von Zwischenfrüchten wird die Stickstoffbindung im Boden optimiert. Dies verbessert nicht nur die Bodenstruktur, sondern erhält auch langfristig die Fruchtbarkeit der landwirtschaftlichen Flächen. Dadurch wird der Kreislaufgedanke gefördert und der Einsatz externer Düngemittel minimiert.
Dauergrünland als CO₂-Speicher und Biodiversitäts-Hotspot
In Österreich nimmt Dauergrünland etwa die Hälfte der landwirtschaftlichen Nutzfläche ein und spielt eine zentrale Rolle in der regenerativen Landwirtschaft. Mit seinem hohen Humusgehalt dient es als bedeutender CO₂-Speicher und leistet somit einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz. Gleichzeitig bietet es eine hohe Biodiversität, da es Lebensraum für zahlreiche Pflanzen- und Tierarten schafft.
Auch auf Dauergrünland sind Leguminosen, insbesondere verschiedene Kleearten, weit verbreitet. Diese Pflanzen bereichern den Boden mit Stickstoff und dienen gleichzeitig als wertvolle Eiweißquelle für Wiederkäuer wie Rinder, Schafe und Ziegen. Diese Tiere können unverdauliche Pflanzenfasern in hochwertige Nahrungsmittel wie Milch und Fleisch umwandeln und tragen damit zur nachhaltigen Lebensmittelproduktion bei.
Geschlossene Nährstoffkreisläufe und natürliche Schädlingsregulation
Ein weiteres Merkmal der regenerativen Landwirtschaft ist das Prinzip geschlossener Nährstoffkreisläufe. Düngemittel wie Gülle und Mist, die in der Tierhaltung anfallen, werden gezielt für den Ackerbau genutzt. Dadurch wird der Boden mit essenziellen Nährstoffen versorgt, ohne auf chemisch-synthetische Mittel zurückgreifen zu müssen.
Zudem wird durch eine hohe Biodiversität die natürliche Schädlingsregulation unterstützt. Vielfältige Pflanzen- und Tiergemeinschaften sorgen für stabile Ökosysteme, die den Einsatz chemischer Pestizide überflüssig machen. Dies schützt nicht nur den Boden, sondern auch die Umwelt insgesamt.
Weidehaltung und Ernährungssicherheit
Die extensive Weidehaltung ist ein zentraler Bestandteil der regenerativen Landwirtschaft. Wiederkäuer sind in der Lage, für den Menschen unverdauliche Pflanzenfasern in wertvolle tierische Produkte umzuwandeln. Besonders auf Grünlandstandorten, die sich nicht für den direkten Anbau von Nahrungsmitteln eignen, ermöglicht die Weidehaltung eine nachhaltige Nutzung der Ressourcen.
Durch den gezielten Einsatz von Weidetieren wird zudem die Bodenverbesserung gefördert. Das natürliche Verhalten der Tiere trägt zur Humusbildung bei, fördert die Kohlenstoffspeicherung und verbessert die Bodenstruktur. So entsteht ein nachhaltiges landwirtschaftliches System, das nicht nur zur Ernährungssicherheit beiträgt, sondern auch langfristig die Produktivität der Böden erhält.
Bio-Landwirtschaft und regenerative Landwirtschaft – Gemeinsamkeiten und Unterschiede
Biologische Landwirtschaft
Wichtig zu beachten ist jedoch: Nicht jede biologische Landwirtschaft ist auch automatisch regenerativ. Bio-Betriebe befolgen strenge Richtlinien und verzichten unter anderem auf chemisch-synthetische Düngemittel.
Darüber hinaus ist die Weidehaltung in der Bio-Landwirtschaft verpflichtend, was zu einer naturnahen und nachhaltigen Tierhaltung beiträgt. Besonders in Regionen wie Salzburg, wo fast ausschließlich Grünland bewirtschaftet wird, ist der Bio-Anteil besonders hoch. Dies zeigt, dass die nachhaltige Nutzung von Grünland und Weideflächen eine wesentliche Rolle in der biologischen Landwirtschaft spielt.
Die Biologische Landwirtschaft basiert auf gesetzlich definierten Prinzipien wie Kreislaufwirtschaft, Verzicht auf chemisch-synthetische Düngemittel und Pflanzenschutzmittel sowie Förderung der Bodenfruchtbarkeit durch natürliche Methoden wie Kompostierung und Fruchtfolgen.
Regenerative Landwirtschaft
Regenerative Landwirtschaft hingegen geht über diese Standards der Bio-Landwirtschaft hinaus, indem sie gezielt darauf abzielt, Bodenfruchtbarkeit nicht nur zu fördern, sondern zu verbessern und Ökosysteme aktiv zu regenerieren. Die regenerative Landwirtschaft fokussiert sich dabei auf den Humusaufbau, die Verbesserung der Bodengesundheit und Kohlenstoffbindung sowie die Wiederherstellung lokaler Nährstoffkreisläufe. Ziel ist ein gesunder Boden mit hoher Wasserspeicherfähigkeit, der und Resilienz gegenüber Extremereignissen.
Das es für die regenerative Landwirtschaft keine strengen gesetzlichen Vorgaben gibt sowie keine einheitlichen Standards, kann sie daher sowohl von Bio-Betrieben als auch von konventionellen Landwirten angewandt werden, die bewusst auf bodenschonende und nachhaltige Methoden setzen.
Regenerative Landwirtschaft: ein Fazit
Die regenerative Landwirtschaft geht über Nachhaltigkeit hinaus – sie verbessert nämlich aktiv die natürlichen Ressourcen, anstatt sie nur zu erhalten. Durch den gezielten Einsatz von Leguminosen, den Erhalt von Humus und die Nutzung tierischer Düngemittel wird die Bodenfruchtbarkeit langfristig gesichert und die Biodiversität gefördert. Darüber hinaus trägt sie zur Reduktion von CO₂ in der Atmosphäre bei und stärkt die Resilienz der Landwirtschaft gegenüber Umweltveränderungen. Sie stellt damit eine zukunftsweisende Methode dar, um Landwirtschaft im Einklang mit der Natur zu betreiben und kommenden Generationen fruchtbare Böden zu hinterlassen.
Titelbild @ Rick van der Haar via unsplash (Zugriff 01.04.2025)