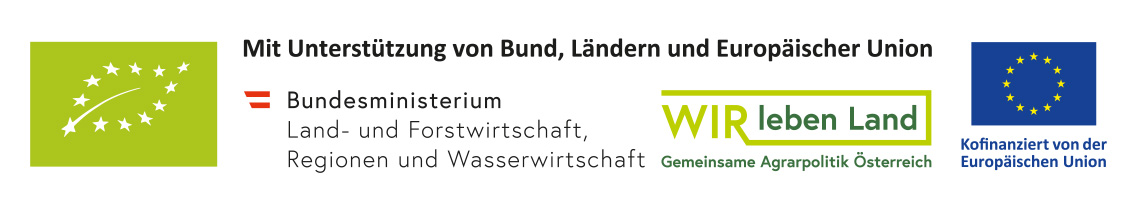Stichwort: Regionale Ehrlichkeit. Joachim Knapp, ein Landwirt aus dem Pustertal in Südtirol, wollte auf einer Skihütte am Kronplatz ein gutes Stück Fleisch genießen. Doch statt eines regionalen Produkts, wie es die Speisekarte versprach, fand er auf seinem Teller Fleisch aus Übersee. Sein Erlebnis teilte er in einem Facebook-Post, der mittlerweile viral gegangen ist und viele Menschen zum Nachdenken anregt. In diesem Artikel erfährst wie es um die regionale Ehrlichkeit bestimmt ist.
Regionale Ehrlichkeit: Von regionaler Herkunft keine Spur
Laut Knapp bestellte er eine „Tagliata vom heimischen Rind“ und fragte nach der Herkunft des Fleisches. Die Bedienung bestätigte, dass es von einem Metzger aus Olang stamme. Doch der Landwirt blieb skeptisch und hakte weiter bei der Geschäftsleitung nach. Der Chef der Hütte versicherte ihm ebenfalls, dass es sich um ein regionales Produkt handle. Erst ein Blick in die Kühlzelle offenbarte die Wahrheit: Das servierte Fleisch war „Black Angus“ aus dem Ausland!
Regionale Unehrlichkeit: Ein weitverbreitetes Problem
Joachim Knapp sieht in diesem Vorfall keinen Einzelfall. Begriffe wie „regional“ oder „heimisch“ würden, dem Landwirt zufolge, in der Gastronomie oft verwendet, ohne dass die Produkte tatsächlich aus der Umgebung stammen. Dabei profitiert gerade die Tourismusbranche von der Arbeit der Landwirte, die mit ihrer Pflege der Kulturlandschaft zur Attraktivität der Region beitragen. Doch während Gastronomen und Hoteliers von dieser malerischen Landschaft leben, haben viele Landwirte mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen.
Forderung nach mehr regionaler Ehrlichkeit
Der Landwirt appelliert deshalb an mehr Fairness und Transparenz in der Gastronomie. „Wenn regionale Produkte angepriesen werden, sollten diese auch wirklich aus der Region stammen“, fordert Knapp. Er ruft Gäste dazu auf, gezielt nach der Herkunft ihrer Speisen zu fragen und sich nicht mit unprüfbaren Versprechen abspeisen zu lassen. Gleichzeitig fordert er von Gastronomen mehr Ehrlichkeit: „Sagt, was ihr tut, und tut, was ihr sagt. Ehrlichkeit zahlt sich aus – für alle.“
Pikantes Detail: kurz nach dem Post des Landwirts meldete sich eine Metzgerei aus Olang zu Wort – die vermeintliche Metzgerei von der die Almhütte scheinbar ihr regionales Fleisch beziehen soll – und stellte klar, die Almhütte eben nicht zu beliefern, da sie gar kein Black Angus führen und eben „keine Hütte auf dem Kronplatz mit Edelteilen“ mit regionalen Erzeugnissen versorgen.
Der Metzgereibetrieb beendet sein Kommentar unter Kopps Post mit der Unterstützung seines Appell an die Konsumenten: „Fragt nach, fordert Klarheit – und vor allem: Seid ehrlich!“
Speisekartenbezeichnungen entsprechen nicht immer der Realität
Joachim Knapp hat nicht Unrecht, denn es stimmt, dass die Verwendung von Begriffen wie „heimisch“ oder „regional“ auf Speisekarten nicht immer der Realität entspricht. Das Problem der falschen Kennzeichnung von Speisen ist in der Gastronomiebranche tatsächlich weit verbreitet.
Regionale Ehrlichkeit: „regional“ ohne festgelegte Definition
Ein weiteres Problem: Der Begriff „regional“ ist dabei rechtlich nicht geschützt und kann daher auch unterschiedlich definiert werden. Er kann sich beispielsweise auf den Großraum des Ortes, in dem man sich befindet, beziehen. Er kann sich aber auch auf einen Landkreis oder ein ganzes Bundesland beziehen. Was als regional gilt, ist somit nicht klar festgelegt und kann daher von Restaurant zu Restaurant variieren.
In Supermärkten stellt sich die Situation anders dar, jedoch ebenfalls problematisch: Berliner KundInnen zum Beispiel können mitunter Waren entdecken, die als „regional“ oder „aus der Heimat“ deklariert sind, obwohl sie beispielsweise aus Bayern kommen. Je nach Auslegung ist diese Kennzeichnung zwar nicht gänzlich falsch, kann jedoch als irreführend empfunden werden, da die betreffenden Produkte bereits eine lange Transportstrecke hinter sich haben.
Gewährleistung einer konstanten Verfügbarkeit und Qualität
Weiteres Problem für viele Betriebe: Die konsequente Verwendung regionaler Produkte kann schwierig sein, besonders bei der Gewährleistung einer konstanten Verfügbarkeit und Qualität. Das entschuldigt natürlich nicht, sich eine regionale Herkunft auf die Fahnen zu heften, wo keine Regionalität gegeben ist. Eine irreführende Verwendung von Begriffen wie „regional“ oder „heimisch“ kann durchaus als Form der Verbrauchertäuschung betrachtet werden.
Um diesem Problem der Falschkennzeichnung entgegenzuwirken, wäre es eine Idee, auch was das Thema Regionalität angeht, vermehr auf Initiativen zur Zertifizierung und Qualitätskontrolle zu setzen. Solche Maßnahmen können dazu beitragen, die Glaubwürdigkeit regionaler Angebote zu erhöhen und VerbraucherInnen mehr Sicherheit bieten. Vor allem, was das Fleisch angeht wäre eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung wichtig. Ein Ansatz, der in Schweden schon umgesetzt wird, wie hier nachzulesen ist.
Herausforderungen der regionalen Gastronomie: Saisonalität und Logistik meistern
Die Verwendung regionaler Produkte stellt die Gastronomie vor besondere Herausforderungen, insbesondere durch die Saisonalität. Nicht alle Zutaten sind das ganze Jahr über verfügbar, was flexible Menüplanung und kreative Alternativen erfordert. Zudem können saisonale Engpässe die Beschaffung erschweren, weshalb enge Partnerschaften mit Lieferanten essenziell sind.
Die Zusammenarbeit mit kleineren Erzeugern bringt logistische Hürden mit sich, da diese oft unregelmäßige Lieferzeiten haben. Langfristige Kooperationen und eine anpassungsfähige Küche sind daher entscheidend, um regionale Zutaten erfolgreich in der Gastronomie zu etablieren.
Regionale Ehrlichkeit: Die Kennzeichnung als Chance
Anstatt sich über einen vermeintlichen „Kontrollwahn“ zu beschweren, können GastronomInnen diesen Ansatz als eine wertvolle Chance begreifen, die eigenen Angebote zu schärfen und ein einzigartiges Profil zu entwickeln. Ob in der gehobenen Küche oder im charmanten Bistro um die Ecke: Der Fokus auf die Herkunft der Zutaten kann zum entscheidenden Faktor werden, um sich von der Konkurrenz abzuheben.
Warum eine BIO-Zertifizierung wichtig ist
BIO-zertifizierte Produkte bieten eine kontrollierte Qualität und eine garantierte Transparenz. Die Zertifizierung stellt sicher, dass die Herkunft der Produkte bekannt ist bzw. zurückverfolgt werden kann und bei der Produktion strenge ökologische Standards eingehalten wurden.
Der Umstieg auf den Anbau biologischer Erzeugnisse ermöglicht es den Bauern nachhaltig regionale Absatzmärkte zu sichern und Teil eines wachsenden Marktes zu werden. Darüber hinaus können in der BIO-zertifizierten Gastronomie die Gäste darauf vertrauen, dass sie Lebensmittel aus überprüften Quellen erhalten.
Für Gastronomen und Konsumenten bedeutet das: Wer BIO-zertifizierte Betriebe unterstützt, setzt auf Transparenz, Nachhaltigkeit und eine bewusste Wahl für hochwertige Lebensmittel. Mehr Informationen dazu finden sich im Leitfaden zur BIO-Zertifizierung.
Titelbild @ Eiliv Aceron via unsplash (Zugriff 24.03.2025)